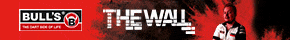5D Dartsscreen Praxistipp
Der Umstand, dass Instruktionen zur Bewegungsausführung eine Hemmung des Lernerfolgs darstellen, muss auch in Bewegungsanweisungen umgesetzt werden. Während Anweisungen wie „Spannen Sie den Gesäßmuskel während der Streckung der Beine an“ den internen Fokus bedienen, ist eine Anweisung (bildhaft auf das Ergebnis ausgerichtet) wie „Versuchen Sie, während Sie die Beine strecken, eine imaginäre Münze mit Ihrem Gesäß einzuklemmen“ auf den externen Fokus gerichtet.
Für das Dartspiel wäre eine Anweisung wie „Versuchen Sie den Arm komplett zu strecken und dabei den Oberarm möglichst ruhig zu halten“ auf den internen Fokus gerichtet und somit nicht zielführend. Hier kann das Bild helfen: „Stellen Sie sich vor, dass Ihr Oberarm während des Wurfes auf einem Kasten fest und ruhig aufliegt.“ Man kann aber auch auf verbale Anweisung verzichten, dafür aber eine Bewegungsbegrenzung anbringen (vgl. Abbildung 1), die das Heben bzw. Senken des Oberarms bewusst machen. Studien (vgl. Wulf, 2009) belegen, dass die Konzentration auf das Ergebnis, der externe Fokus bzw. eine visuelle Darstellung (optisches Feedback z. B. über den PC), der Bewegungsqualität das Lernergebnis signifikant steigert. Dies in den jeweiligen Bewegungsformen zu etablieren, ist essenziell.
Abbildung 1: Externer Fokus auf die Position des Oberarms
Feedback geben
Lenkt man bei einem Sportler mit gewisser Bewegungserfahrung die Aufmerksamkeit auf die Bewegung an sich (interner Fokus), wird sich das als Störung auswirken, da der Sportler darüber nachzudenken beginnt. Das ist etwas, das von Trainern und Therapeuten häufig gemacht wird, allerdings mit gegenteiliger Intention. Die Bedenken, Sportler vom Bewegungsfeedback abhängig zu machen, sind nicht begründet, sofern es sich um ein am externen Fokus orientiertes Feedback handelt. Bei Feedback mit internem Fokus ist jedoch genau das Gegenteil der Fall: Besonders schädlich ist unmittelbares Feedback mit internem Fokus und zeitgleichen Bewegungsanweisungen.
Bei Feedback mit externem Fokus ist ein Absinken der Leistung nicht zu erwarten, wenn das Feedback plötzlich fehlt. Das bedeutet, dass das Training unter unmittelbaren Feedbackbedingungen ausnahmslos positiv zu werten ist, da Trainingsgruppen unter Lernbedingungen mit unmittelbarem Feedback und externem Fokus einen deutlich höheren Lernerfolg aufweisen als Gruppen mit auf internen Fokus orientiertem Feedback und Gruppen ohne Feedback (vgl. Wulf, 2009).
Merke:
Ein Feedback mit externem Fokus führt zu besseren Lernergebnissen als jenes mit internem Fokus. Daraus ist ableitbar, dass sich die Vorteile des externen Fokus in Anweisungen auch auf das unmittelbare Feedback umlegen lassen!
Übungen für die Praxis
Nun werden Übungen zur Wurftechnik vorgestellt, die zusätzlich zum normalen Training und Spiel durchgeführt werden sollten. Die Übungen, die sich am 5D-Screening orientieren, sollten nur bei Einschränkungen im betreffenden Teilbereich absolviert werden. Wird ein Normwert erreicht, besteht auch kein Handlungsbedarf. Die Übungen haben den Sinn, den Wurfstil zu verbessern, um die Basis für ein stabiles Scoring zu legen. Die im Rahmen dieser Übungen getroffenen Felder am Board sollten vernachlässigt werden. Kann man das nicht ganz ausschalten und wird man durch ein unübliches Trefferbild verunsichert, sollte auf ein neutrales Board gespielt werden oder das Board abgedeckt werden. Bei der Durchführung der Übungen ist zu beachten, dass diesen immer ein kurzes Einspielen vorausgehen sollte. Achtung: Jede Veränderung benötigt Zeit, die Übungen sollten über mehrere Wochen wiederholt werden. Für das Techniktraining sind folgende Eckdaten empfehlenswert:
Die Übungen sollten 5–10 Aufnahmen wiederholt werden. Nach einer Pause von ungefähr 1–5 Minuten sollte mit der zweiten Serie begonnen werden. Es können vier Serien absolviert werden. Merke: Falls an den beschriebenen Teilbereichen geübt werden sollte, ist es ganz entscheidend, sich immer nur einem Teilbereich zu widmen, da ansonsten bei geteilter Aufmerksamkeit kein beziehungsweise ein deutlich geringerer Fortschritt zu erwarten ist.
1.) Wurf mit offenen und geschlossenen Augen
Die Tiefensensibilität (Propriozeption) ist ein entscheidender Bestandteil jeder Bewegung. Dies trifft auch für den Dartsport zu. Mulligan et al. (2013) geben ganz klar die Empfehlung für ein Training der Tiefensensibilität auch im Dartsport. Die Übung kann folgendermaßen durchgeführt werden:
Nach einem kurzen Einwerfen auf unterschiedliche Ziele (häufige Triple-Felder sind dabei empfehlenswert) sollte ein Ziel ausgewählt werden. Das Ziel wird fixiert, der Stand eingenommen, und dann werden die Augen geschlossen. Anfangs können als unmittelbares Feedback nach jedem Pfeil die Augen geöffnet werden, später sollten alle drei Pfeile mit geschlossenen Augen geworfen werden.
2.) Stabilität des Oberarmes – Korridor
Um die Stabilität des Oberarmes zu trainieren, sollte man es vermeiden, an die richtige Position zu denken. Vielmehr sollte eine Situation geschaffen werden, in der der Oberarm nicht bewegt werden kann, ohne an einer Begrenzung anzustoßen. Es empfiehlt sich dabei, einen Bewegungskorridor zu schaffen (siehe Abbildung 1), bei der nur eine geringe Bewegungsmöglichkeit für den Oberarm vorhanden ist. Der Wurf wird mit dieser Einschränkung trainiert.
Abbildung 2: Stabilität des Oberarmes – Korridorübung
3.) Bewegungsausmaß
a) Startpunkt berühren
Um das Bewegungsausmaß zu verbessern, und hier speziell die Ausholbewegung, ist es empfehlenswert, eine Startposition zu berühren. Dabei wird ein Bewegungsbegrenzer hinzugenommen, der etwas weiter hinten als die praktizierte Ausholbewegung angebracht wird. Nach und nach wird nun der Berührungspunkt immer weiter nach hinten verschoben.
Abbildung 3: Bewegungsausmaß – Berührungsübung
b) Bewegungsausmaß „Schlag auf Ziel“
Bei dieser Übung wird das Durchstrecken des Armes erarbeitet. Nach dem Loslassen des Dartpfeils wird die Bewegung so weit durchgezogen, bis mit dem ausgestreckten Arm ein knapp unter Schulterhöhe angebrachtes Ziel „geschlagen“ wird. Das notwendigerweise weiche Ziel gibt auch hier externes Feedback über den Wurf (Abb. 4).
Abbildung 4: Bewegungsausmaß – Ziel schlagen
4.) Wurfstabilität
a) Ampel (Software)
Bei dieser Übung wird die Stabilität des Wurfes trainiert. Anhand des Mittelwerts der erhobenen Wurfstärke werden im Trainingsprogramm die Werte eingegeben, höhere Abweichungen als 300 counts sollten vermieden werden. Für diese Übung ist die Verwendung der beschriebenen Software und von Beschleunigungsmessern notwendig.
b) Wurfstabilität Trichter/trapezförmiges Ziel
Auch ohne Rückmeldung über den PC kann an der Wurfstärke gearbeitet werden. Es wird ein A4-Papier längs gefaltet (Abb.5). Dabei wird ein, je nach Niveau, 0,8 bis 3cm breiter Korridor gefaltet. Mithilfe dreier Dartpfeile wird das zum Spieler offene Trapez an der Dartscheibe befestigt. Der untere Teil des Papiers wird horizontal angebracht, während der obere Teil je nach Wurfstärke flacher oder steiler angebracht wird. Nun versucht der Spieler, mit den drei Pfeilen möglichst in derselben Höhe die drei Markierungen, die links, mittig und rechts aufgemalt werden, zu treffen. Der Aufprallwinkel des Pfeiles gibt Rückmeldung über die Wurfstärke.
Abbildung 5: Wurfstabilität – Trichterübung
5.) Seitliche Abweichung
a) Ampel/Balken (Software)
Ähnlich der Wurfstabilität wird mittels Sensor und Software gespielt. Die Ampel wird mit den individuellen Abweichungen angepasst und Schritt für Schritt wird versucht, die seitliche Abweichung zu reduzieren. Bei einer sehr ausgeprägten Streckphase des Armes sollte mit der Visualisierung der Kurve gearbeitet werden, da durch die starke Streckung sehr hohe Werte auch in der seitlichen Achse auftreten können.
b) Seitliche Abweichung/Nähe zur Wand
Die seitliche Abweichung kann auch reduziert werden, indem eine Wand (z. B. Roll-up) aufgestellt wird. Diese wird bei Rechtshändern rechts vom Spieler in Nähe der Schulter aufgestellt. Der Spieler versucht nun, die gesamte Wurfbewegung möglichst im gleichen Abstand zur Wand durchzuführen. Vor allem der Ellbogen darf die Wand nicht berühren, beziehungsweise sollte der Abstand zur Wand immer gleich sein.
6.) Stand
a) Ampel (Software)
Mittels der Visualisierung der Ampel werden die Beschleunigungswerte dargestellt. Während des Wurfes sollte die senkrechte Beschleunigung den ermittelten Cut-off nicht überschreiten. Auch für diese Übung sind die in der Studie verwendete Software und auch der Sensor notwendig (Abb. 6).
Abbildung 6: Standstabilität – Ampelübung
b) Bild des Baumes/Grashalmes
Durch Visualisierung des eigenen Standes als Baum oder als Grashalm (wenn man einen eher wiegenden Stand hat) kann die vertikale Beschleunigung reduziert werden. Bei jedem Wurf, vor allem aber beim dritten Pfeil, versucht man sich dieses Bild vorzustellen.
c) Stabilisationstrainer
Mithilfe einer schwingenden Platte kann der stabile Stand ebenfalls erlebt werden. Die Platte verstärkt dabei die horizontalen und vertikalen Schwankungen während des Wurfes und ist möglichst stabil zu halten (Abb. 7).
Abbildung 7: Standstabilität – Übung mit Stabilisationstrainer
Literatur
- Mulligan D., Hodges N. J.: Throwing in the dark: improved prediction of action outcomes following motor training without vision of the action. Psychol Res. 2013 Nov 12. [Epub ahead of print]
- Singer R. N.: Strategies and metastrategies in learning and performing self-paced athletic skills, Sport Psychologist, 1988, 2, 49–68
- Wulf G.: Aufmerksamkeit und motorisches Lernen, Urban und Fischer, München, 2009
Der 5D Dartsscreen zur Erhebung von leistungsbestimmenden und leistungshemmenden Parametern beim Dartwurf anhand von fünf Variablen
© Harald Jansenberger @ Darts1.de